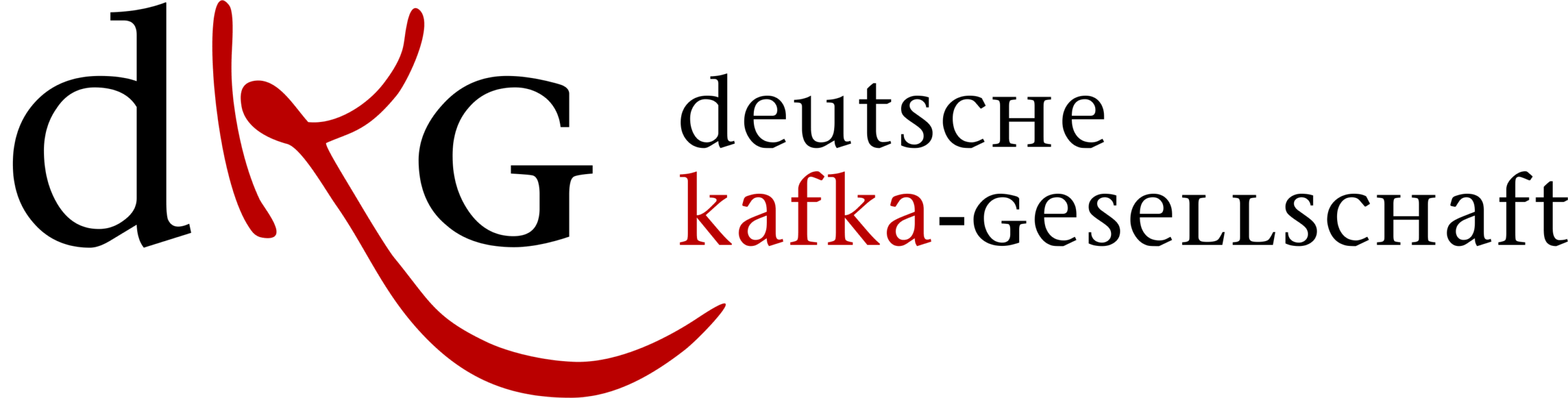Aus dem Call for Papers
Mit den so genannten Cultural Animal Studies hat sich in den letzten Jahren ein Forschungsbereich etabliert, der auch für die Literaturwissenschaften nachhaltige Konsequenzen hat – und dies in dreifacher Hinsicht. Erstens fokussieren die Literaturwissenschaften ‚Tiere in der Literatur’ als historisch bedingte und kulturell motivierte Konstruktionen, in denen anhand der Grenzziehungen zwischen Mensch und Tier Konzepte des Humanen und des Animalischen verhandelt werden. Zweitens arbeiten sie dabei interdisziplinär, indem sie die der jeweiligen Literatur zeitgenössischen Entwicklungen und Positionen berücksichtigen – etwa die Wissenschaften der Biologie, Ethologie und Zoologie, die kulturellen Praktiken der Jagd, der Züchtung und des Tierexperiments und die gesellschaftlichen Institutionen des Zirkus und des Zoos. Drittens fragen sie nach den spezifischen Darstellungsformen, in denen das gesamtkulturelle Wissen um Tiere sowohl in den Wissenschaften als auch in der Literatur entworfen und verarbeitet wird.
Dieser Ansatz der Animal Studies ist im besonderen Maße geeignet, die zahlreichen Tierdarstellungen in Kafkas Texten – vom „Ungeziefer“ Gregor Samsa in DieVerwandlung über den Affen Rotpeter in Ein Bericht für eine Akademie bis hin zu den Mäusen in Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse – in neuer Weise zu perspektivieren. Denn zum einen beugt der Ansatz der Animal Studies durch seine Verpflichtung auf kulturelle Kontexte einer ausschließlich auf den literarischen Text bezogenen Lektüre vor, die bisher vor allem in der Kafka-Forschung praktiziert worden ist und die die Tierfiguren meist parabolisch bzw. allegorisch gelesen hat. Zum anderen stehen Kafkas Tierdarstellung historisch in einer höchst vielschichtigen Gemengelage von Debatten (Evolutionstheorie, Sozialdarwinismus) und Experimenten (Iwan Pawlos Reiz-Reaktions-Untersuchungen an Hunden, Wolfgang Köhlers „Intelligenzprüfungen“ von Affen), Schaustellungen (der Pferde von Elberfeld, des Mannheimer Hundes Rolf sowie der Variété-Affen Moritz und Konsul Peter) und Publikationen (die Autobiographie des Zoodirektors Carl Hagenbeck erscheint erstmals 1909, Brehms Tierleben geht in den 1910er Jahren in die vierte, den zeitgenössischen wissenschaftlichen Standards angepassten Auflage), die eine Analyse seiner literarischen Texte im kulturellen Kontext als notwendig wie fruchtbringend erscheinen lässt.
Für die Tagung „Kafkas Tiere. Kulturwissenschaftliche Lektüren“ sind deshalb Beiträge gesucht, die Kafkas Tiere im Zusammenhang mit der Tierforschung um 1900 lesen und den Fragen nach der Darstellung, Konzeptualisierung und Ausdifferenzierung von Natur und Kultur bzw. von Animalität und Humanität nachgehen.
In Kooperation zwischen der Deutschen Kafka-Gesellschaft, dem Department für Germanistik und Komparatistik der Universität Erlangen-Nürnberg und der Würzburger Summer School for Cultural and Literary Animal Studies
3.-5.10.2014, Universität Erlangen-Nürnberg
Bismarckstraße 1B, Raum B301 & B302
Freitag, 3.10.
15.30 Uhr
Begrüßung durch Dr. Wilko Steffens, Präsident der Deutschen Kafka-Gesellschaft und Prof. Dr. Harald Neumeyer, Universität Erlangen-Nürnberg
16.00 Uhr
Prof. Dr. Roland Borgards (Würzburg): Indianer ohne Pferd. Was sind und was tun Kafkas Tiere?
17.00 Uhr
Kaffeepause
17.30 Uhr
Martin Bartelmus (Würzburg): Animal Sacrum. Franz Kafkas Schakale und Araber als Geschichte der Grenzen
18.15 Uhr
PD Dr. Yvonne Nilges (Eichstätt-Ingolstadt): Kafka, Köhler, Kognitionspsychologie. Rotpeter im kulturellen Kontext zeitgenössischer Schimpansenforschung
Samstag, 4.10.
09.30 Uhr
Helene Dick (Köln): Franz Kafkas Ein Bericht für eine Akademie. Sabotage der anthropologischen Maschine
10.15 Uhr
Dr. Alexandra Böhm (Erlangen-Nürnberg): Kafkas sprechende Tiere und die Emotionswissenschaften der Jahrhundertwende
11.00 Uhr
Kaffeepause
11.30 Uhr
Prof. Dr. Dirk Oschmann (Leipzig): Die Freiheit der Tiere
12.15 Uhr
Joela Jacobs, M.A. (Chicago): Freiheit, ein kümmerliches Gewächs: Tier-Epistemologie und die Frage nach der Willensfreiheit in den Hundeerzählungen Franz Kafkas und Oskar Panizzas
13.00 Uhr
Mittagspause
14.30 Uhr
Sebastian Lübcke, M.A. (Gießen): „Tierliebhaber oder Geschäftsmann“. Kafkas schwache Tiere am Rande einer Gesellschaft der ‚Fitten’
15.15 Uhr
Frederike Middelhoff, M.A. (Würzburg): „Was für ein schreckliches stummes lärmendes Volks das ist“ oder: Warum die Mäuse auf Josefines Gesang pfeifen können. Kafkas Mäuse und Ratten zoologisch betrachtet
16.00 Uhr
Kaffeepause
16.30 Uhr
Dr. David Wachter (Jena): Schweigen – Geräusch – Melodie. Kafkas EthnoGraphie der Musik
17.15 Uhr
Denise Reimann, M.A. (Berlin): „Ein an sich kaum hörbares Zischen“. Kafkas piepsende Ungeziefer, sprechende Affen und unbekannte Zischer im Kontext der Tierphonographie um 1900
Sonntag, 5.10.
09.30 Uhr
Klaus Wiehl, M.A. (Berlin): Ein unscheinbares Kriegstier. Maulwürfe, Soldaten und die Biologie des Krieges in Franz Kafkas ‚Der Bau’
10.15 Uhr
Prof. Dr. Michael Niehaus (Dortmund): Das Bautier
11.00 Uhr
Kaffeepause
11.30 Uhr
Dr. Jochen Thermann (Berlin): Poetologische Kreuzungen
12.15 Uhr
Schlussworte
12.30 Uhr
Treffen der Deutschen Kafka-Gesellschaft